„Eine Zeit ohne Tod“ von José Saramago
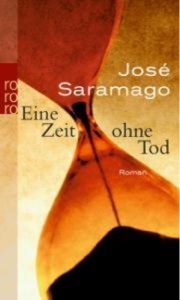 Ich habe vor kurzem erst die Literatur des portugiesischen Nobelpreisträgers José Saramago für mich entdeckt. Der Schöpfer großer fiktiver Szenarien ist bereits 2010 verstorben, es wird also leider kein Werk mehr nachkommen. Nach „Stadt der Blinden“ und „Stadt der Sehenden“ ist „Eine Zeit ohne Tod“ mein dritter Saramago – deshalb: Zeit für eine kleine Rezension:
Ich habe vor kurzem erst die Literatur des portugiesischen Nobelpreisträgers José Saramago für mich entdeckt. Der Schöpfer großer fiktiver Szenarien ist bereits 2010 verstorben, es wird also leider kein Werk mehr nachkommen. Nach „Stadt der Blinden“ und „Stadt der Sehenden“ ist „Eine Zeit ohne Tod“ mein dritter Saramago – deshalb: Zeit für eine kleine Rezension:
Kurzbeschreibung des Rowohlt Verlages:
Und wenn einfach keiner mehr sterben würde?
Es ist der 1. Januar in einem nicht näher bezeichneten Land. Da geschieht, wofür es kein Beispiel in der Geschichte gibt: An diesem Tag stirbt niemand. Und auch am folgenden Tag nicht und am darauffolgenden. Selbst die Königinmutter, bei der es aussah, als würde sie den Jahreswechsel nicht mehr erleben, verharrt im Sterben. Eines Tages findet der Direktor des nationalen Fernsehens einen Brief auf dem Tisch, über dessen Erhalt er umgehend den Ministerpräsidenten in Kenntnis setzt. Der Brief stammt vom Tod …
Wer Saramago zum ersten Mal liest, muss sich erstmal an seinen außergewöhnlichen Stil gewöhnen. Kaum Absätze, immer wieder Kommata, wo man Punkte erwartet. Noch außergewöhnlicher als der Satzaufbau und der Einsatz von Satzzeichen ist allerdings sein Erzählstil. Wenn ein Buch schon damit beginnt, dass in einem fiktiven Land keiner mehr stirbt!
„Falls wir nicht wieder sterben, haben wir keine Zukunft mehr.“
Der Erzähler konstruiert das Ohne-Tod-Szenario mit viel Distanz, welche auch dadurch entsteht, dass zunächst kein einzelner Protagonist auszumachen ist. Personengruppen, Unternehmen, die Krankenkassen, die Kirche – die Gesellschaft – sind seine Protagonisten. Auch typisch für Saramago. Im ersten Teil des Buches beschreibt er ganz genau, wie die sozialen und politischen Gruppen auf die Todlosigkeit reagieren. Die Kirche ist verzweifelt und stellt ihre Existenz in Frage, denn ohne Tod, keine Auferstehung. Familien bringen ihre „Halbtoten“ über die Grenze, um ihnen dort ein Sterben zu ermöglichen. Eine ethische Diskussion bricht aus über diese „unmenschlichen“ Maßnahmen. Es entsteht eine kriminelle Organisation, die sich nun um diese „Tötungen“ kümmert – mit dem Namen Maphia. Sie bringen Todkranke gegen Bezahlung diskret über die Grenze, wenn die dort patrouillierenden Streitkräfte wegschauen.
Handlung: Tod haucht der Geschichte neues Leben ein
Dieser Teil des Buches zeigt Saramagos sozial-politisches und philosophisches Anliegen. Was passiert, wenn der Tod streikt? Ist es Fluch oder Segen? Was sind die gesellschaftlichen Folgen? Diese übergeordnete Ebene der Utopie wirkt stellenweise leider auch ermüdend, gerade durch die fehlende Nähe zu bestimmten Persönlichkeiten. Aber auch diese kurze Strecke des Buches punktet durch die charmante Detailgenauigkeit des Was-wäre-wenn-Szenariums, die einem immer wieder schmunzeln lässt. Bestattungsunternehmen bitten beispielsweise um die gesetzliche Pflicht, Haustiere zu bestatten, weil ihnen die Existenzgrundlage abhanden gekommen ist. Nach und nach versucht also jede Gruppe sich mehr oder weniger mit dem todlosen Leben zu arrangieren.
In die Handlung kommt aber erst durch den Tod wieder richtig Leben. Der streikende tod [sic!] erscheint plötzlich durch einen violetten Brief an die Medien wieder auf der Bildfläche. „Er“ ist genauer gesagt eine „Sie“ – ein weiblicher tod (portugiesisch: morte – fem.). Sie ist außerdem auch nur einer von vielen verschiedenen Toden, deshalb schreibt sie sich klein. Denn „der Tod“ ist nicht nur für ein kleines Land zuständig, sondern für das komplette Sein des Universum und mit ihm kann man somit erst am wirklich letzten Ende Bekannschaft machen. Sie – also tod – hat einen Hang zu Rechtschreibfehlern, trägt viele menschliche Züge und lebt allein mit ihrer sprechenden Sense in einem kalten Gemäuer. Sie beschließt mit diesem Brief also nach sieben Monaten zurückzukehren und führt mit ihrem ersten Schreiben an die Menschen ein neues Sterbeprinzip in dem fiktiven Land ein: Eine Woche vor ihrem Ableben werden die Menschen nun jeweils über ihren Todeszeitpunkt informiert, sodass sie dann beginnen können, in Ruhe ihre letzten Angelegenheiten zu regeln. Sie – also tod – sitzt jetzt somit jeden Tag in ihrer Wohnung und muss 250 Briefe schreiben (denn per Mail sind noch nicht alle bald Sterbenden erreichbar).
Absurditäten bis zum bitteren Ende
Doch auch damit kann sie wohl die undankbaren Menschen nicht zufrieden stellen. Panisch schließen sie eben doch nicht ab, was sie noch abzuschließen hätten. Psychologische Einrichtungen sind überlaufen durch die Vor-Tod-Seelsorge, die jetzt immer wieder zu leisten ist. Doch als ob das nicht alles schon absurd genug wäre, setzt Samarago noch einen drauf:
Einer der violetten Briefe kommt dreimal infolge zurück. Das bringt tod so in Rage, dass sie den untoten Adressaten aufsucht. Sie macht sich in Gestalt einer Frau auf den Weg zu einem alleinstehenden Cellisten, der sich wohl erfolgreich dem Tode widersetzt hat…
An dieser Stelle muss ich aufhören die Handlung zu beschreiben, sonst verderbe ich jedem das Lesevergnügen, aber so viel soll gesagt sein: Der Schluss steht der ganzen Geschichte des Buches in Absurdität nichts nach – er ist überraschend, berührend und tragisch zugleich. Mir ist kurz die Kinnlade runtergefallen, als ich auf der letzten Seite angekommen bin.
Fazit:
Absolut lesenswert, auch wenn der Leser ein wenig Ausdauer und Spaß an utopischen Ideen braucht. Durch die unterschiedlichen Teile der Geschichte wirkt das Buch etwas zerissen, was aber gleichzeitig die Saramago-typische Besonderheit ausmacht.
„Eine Zeit ohne Tod“ – José Saramago
Rowohlt Verlag
256 Seiten
EUR 6,99
ISBN-10: 3498063898
ISBN-13: 978-3498063894
[…] Ich habe vor kurzem erst die Literatur des portugiesischen Nobelpreisträgers José Saramago für mich entdeckt. Der Schöpfer großer fiktiver Szenarien ist bereits 2010 verstorben, es wird also leider kein Werk mehr nachkommen. Nach “Stadt der Blinden” und “Stadt der Sehenden” ist “Eine Zeit ohne Tod” mein dritter Saramago – deshalb: Zeit für eine kleine Rezension auf der Geilen Zeile… […]